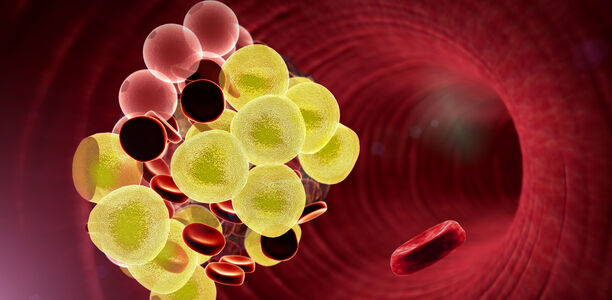Forschende der ETH Zürich haben mit dem bislang einfachsten Ansatz aus menschlichen Nierenzellen künstliche Betazellen hergestellt. Diese sind wie das natürliche Vorbild sowohl Zuckersensoren als auch Insulinproduzenten.
Mit einem verhältnismäßig einfachen Ingenieuransatz haben Forscherinnen und Forscher um ETH-Professor Martin Fussenegger am Departement Biosysteme in Basel künstliche Betazellen hergestellt. Diese können alles, was natürliche Beta-Zellen auf der Bauchspeicheldrüse leisten: Sie messen die Glukosekonzentration im Blut und sie bilden genügend Insulin, um den Blutzuckerspiegel wirkungsvoll zu senken. Ihre Entwicklung präsentierten die ETH-Forscher in der neusten Ausgabe der Fachzeitschrift „Science“.
Bisherige Ansätze beruhten auf Stammzellen, die die Wissenschaftler zu Betazellen ausreifen liessen, entweder durch Zugabe von Wachstumsfaktoren oder durch den Einbau von komplexen genetischen Netzwerken.
Für ihren neuen Ansatz verwendeten die ETH-Forschenden eine Zelllinie, die auf menschlichen Nierenzellen beruht, sogenannte HEK-Zellen. Die Forscher nutzten die natürlichen Glukose-Transportproteine und Kalium-Kanäle in der Membran der HEK-Zellen. Diese erweiterten sie um einen spannungsabhängigen Kalziumkanal sowie um Gene zur Produktion von Insulin und GLP1, einem Hormon, das ebenfalls an der Regulierung des Blutzuckerspiegels beteiligt ist.
Spannungsumkehr bewirkt Insulinproduktion
In den künstlichen Beta-Zellen befördert das natürliche Glukose-Transportprotein der HEK-Zellen Glukose aus dem Blut ins Zellinnere. Sobald der Blutzuckerspiegel eine gewisse Schwelle überschreitet, schließen sich die Kalium-Kanäle. Dadurch kippt die Spannungsverteilung an der Membran, die Kalzium-Kanäle öffnen sich und das einströmende Kalzium löst eine in die HEK-Zellen eingebaute Signalkaskade aus an deren Ende die Produktion und Ausschüttung von Insulin beziehungsweise GLP1 stehen.

So funktioniert schematisch die von den Forschern der ETH Zürich entwickelte künstliche Betazelle.
Die Wissenschaftler testeten die künstlichen Betazellen vorerst in Mäusen. Dabei entpuppten sich die Zellen als äußerst leistungsfähig: "Sie funktionierten besser und länger als alle bisher weltweit erreichten Lösungen", betont Fussenegger. In diabetischen Mäusen implantiert, produzierten die modifizierten HEK-Zellen während drei Wochen zuverlässig und in ausreichenden Mengen die Blutzuckerspiegel regulierenden Botenstoffe.
Hilfreiche Modellierung, passgenau für alle Diabetiker
Für die Entwicklung der künstlichen Zellen war den Forschern ein Computermodell hilfreich, das Forschende um Jörg Stelling, ein weiterer Professor des Departements Biosysteme der ETH Zürich, erstellten. Das Modell ermöglicht Prognosen des Zellverhaltens, die sich experimentell überprüfen lassen. "Die Daten aus den Experimenten und die mit den Modellen errechneten waren fast deckungsgleich", sagt Fussenegger.
Er und seine Gruppe beschäftigen sich schon seit längerem mit biotechnologischen Lösungen zur Therapie von Diabetes. Vor mehreren Monaten präsentierten sie Betazellen, die sie aus Fettstammzellen einer Person heranzüchteten. Diese Technik ist allerdings teuer, da die Betazellen für jeden Patienten individuell hergestellt werden müssen. Die neue Lösung wäre günstiger, da dieses System für alle Diabetiker passt.
Langer Weg zur Marktreife
Wann die künstlichen Betazellen auf den Markt kommen, ist allerdings ungewiss. Sie müssen erst verschiedene klinische Tests durchIaufen, ehe sie im Menschen verwendet werden könnten. Solche Tests sind aufwendig und dauern oft mehrere Jahre. "Meistern unsere Zellen alle Hürden, könnte sie in 10 Jahren auf den Markt kommen", schätzt der ETH-Professor.
Im Jahr 2040 werden gemäß Schätzungen der International Diabetes Federation über 640 Millionen Menschen weltweit an Diabetes erkrankt sein. In der Schweiz sind heute eine halbe Million Menschen betroffen. 40.000 davon leiden an Typ-1-Diabetes, der Form also, bei der das körpereigene Immunsystem die insulinproduzierenden Betazellen der Bauchspeicheldrüse restlos zerstört.
Quelle: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich)