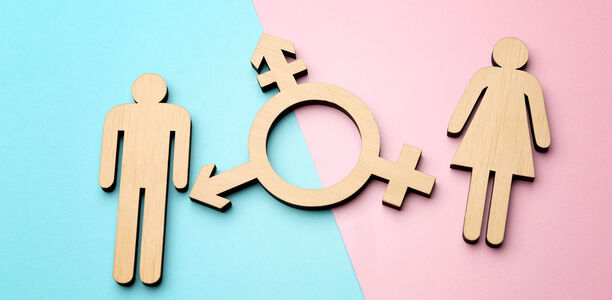Die Vorstellung von der Natürlichkeit und Unveränderbarkeit der Existenz zweier Geschlechter prägt nahezu jeden Lebensbereich des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Besonders spürbar wird dies im Kontext von Schwangerschaft und Geburt, wenn die Frage nach dem Geschlecht eines Kindes eine große Bedeutung bekommt und nicht nur die Farbe der Kleidung, sondern auch die Erwartung an Persönlichkeitseigenschaften und Lebenswege prägen kann.
Fast jeder Lebensbereich von Annahme der Existenz zweier Geschlechter geprägt
Viele Menschen sind cis-geschlechtlich (lat.: diesseits [der Geschlechtszuweisung]) und können sich mehr oder weniger gut mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Sie finden sich oft ohne schwerwiegende Probleme in den gesellschaftlich gelebten Erwartungen von männlich oder weiblich wieder.
Bei trans Personen keine oder wenig Identifikation mit dem Zuweisungsgeschlecht
Für trans-geschlechtliche Personen (lat.: jenseits [der Geschlechtszuweisung]) trifft dies nicht zu. Sie erleben keine oder nur wenig Übereinstimmung zwischen dem Geschlecht, das ihnen aufgrund ihres Genitales bei Geburt zugewiesen wurde, und ihrer Geschlechtsidentität. Das geschlechtliche Selbstverständnis kann sich sowohl innerhalb des zweigeschlechtlichen Modells (trans männlich/trans weiblich) als auch außerhalb dessen, z. B. als nicht-binär oder genderqueer, wiederfinden. Die Nicht-Übereinstimmung mit dem Zuweisungsgeschlecht kann sowohl auf einer psychischen, sozialen (gesellschaftlichen) als auch auf einer körperlichen Ebene erlebt werden und zu einem erheblichen Leidensdruck und psychischen Erkrankungen führen. Hieraus ergibt sich ein für viele trans Personen dringender Bedarf einer Behandlung, die sowohl Beratung und Psychotherapie als auch somatische Interventionen (z. B. Hormonbehandlung und chirurgische Eingriffe) umfassen kann (DGfS: Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung 2018).
Erschwerter Zugang zu bedarfsgerechter Versorgung
Der Zugang zu einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung ist für trans Personen aufgrund struktureller Barrieren erheblich erschwert (Renner J et al. 2021). Im Gesundheitssystem treffen trans Personen häufig auf mangelndes, trans-spezifisches Fachwissen sowie auf Unsicherheit auf Seiten der behandelnden Fachkräfte (Brandt G et al. 2022; Eyssel J et al. 2017). Hierdurch besteht für Behandlungssuchende die Gefahr, Diskriminierungen (Lampalzer U et al. 2019), Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen zu erleiden (Brandt G et al. 2022). Dies kann z. B. durch die Nutzung der falschen Pronomina oder durch die automatische Erwartung zum Genitalstatus einer Person aufgrund ihrer äußeren Erscheinung geschehen (Brandt G et al. 2022). Der Verweis auf trans-spezifische Behandlungsangebote ist nicht immer möglich, da diese vor allem in großstädtischen Regionen vorhanden sind und daher für viele Behandlungssuchende lange Anfahrtswege, Kosten sowie Arbeitszeitausfall bedeuten (Renner J et al. 2021).
ICD-11 inkludiert nicht-binäre Identifikationen
In der 11. Revision der Internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-11 (WHO 2018)) findet sich Transgeschlechtlichkeit als Geschlechtsinkongruenz im neu geschaffenen Kapitel "Zustände im Bereich der sexuellen Gesundheit", abseits von psychischen Erkrankungen, wieder. In dieser Überarbeitung ist eine vielschichtige Veränderung abzulesen, die sich einerseits auf eine Auseinandersetzung mit der Pathologisierung von trans Personen und andererseits auf eine Öffnung für geschlechtliche Vielfalt über das Modell der Zweigeschlechtlichkeit hinaus bezieht. Während für die ICD-10 noch Zweigeschlechtlichkeit der maßgebende Rahmen war (Mann zu Frau, Frau zu Mann), inkludiert das ICD-11 auch nicht-binäre Identifikationen. Damit können sich Behandlungsverläufe stärker als bisher von einer Anpassung des Individuums an soziale Normvorstellungen von Geschlecht lösen. Stattdessen wird ein Raum für individuelle Behandlungsprozesse eröffnet, die den persönlichen Nutzen einer somatischen Behandlung für die einzelne Person fokussiert.
S3-Leitlinie empfiehlt individuellen und ganzheitlichen Ansatz
Die 2018 publizierte S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung bei Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit (DGfS 2018) fokussiert diese Individualität der Behandlungsprozesse in der Trans-Gesundheitsversorgung. Anstelle von ehemals vorgeschriebenen rigiden Anforderungen an den Beginn von körpermodifizierenden Behandlungen (z.B. Psychotherapie, Alltagstest) und starren Abfolgen (z.B. chirurgische Maßnahmen erst im Anschluss an den Beginn der Hormonbehandlung) wird ein individuell abgestimmter, ganzheitlicher Ansatz empfohlen, dessen Behandlungsangebot Beratung, psychotherapeutische Begleitbehandlung und somatische Maßnahmen beinhalten kann. Die Passung einer somatischen Behandlung wird individuell vor dem Hintergrund der Lebensrealität der behandlungssuchenden trans Person durch partizipative Entscheidungsfindung gemeinsam geprüft.
Erfordernis einer Stellungnahme zur medizinischen Notwendigkeit
Behandlungsprozesse in der Trans-Gesundheitsversorgung werden maßgeblich von der Erfordernis einer Stellungnahme zur medizinischen Notwendigkeit, d. h. der Indikation der entsprechenden Behandlung beeinflusst (Begutachtungsrichtlinie MDS 2020; Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen). Um diese zu erhalten, müssen sich Behandlungssuchende auch ohne ein psychotherapeutisches Anliegen in ein psychiatrisch-psychotherapeutisches Setting begeben, um die Indikation zur der von ihnen angestrebten somatischen Behandlung zu erhalten. Psychotherapeutisch arbeitende Fachkräfte finden sich daher in einer institutionell angelegten "gate-keeping" Rolle wieder. Der Bundesverband Trans* (BVT*) schlägt das Modell der informierten Zustimmung in Bezug auf somatische Behandlungen vor (DGfS 2018). Hierbei würde die Entscheidung über somatische Behandlungen nach einer ausführlichen Aufklärung allein bei der behandlungssuchenden trans Person liegen.
Strukturelle Bedingungen können vertrauensvollen Therapieprozess gefährden
Diese strukturellen Rahmenbedingungen können einen vertrauensvollen therapeutischen Prozess gefährden, in dem die behandlungssuchende trans Person von dem Fachwissen der behandelnden Person profitieren kann. Für Behandler:innen ist es daher notwendig, einen proaktiven, transparenten Umgang mit diesen Bedingungen im therapeutischen Kontakt zu etablieren. Hierzu gehört eine laufende Reflexion der eigenen "gate-keeping" Rolle, die ebenso eine Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen von Geschlechtlichkeit beinhaltet. Enge, binäre Vorstellungen können die Möglichkeit beeinträchtigen, einer behandlungssuchenden trans Person, insbesondere vor Beginn ihrer medizinischen Transition, mit einer akzeptierenden, wohlwollenden Haltung in ihrer Geschlechtsidentität zu begegnen.
Gemeinsame Planung des Transitionsweges im Transgender-Versorgungscentrum
Im Interdisziplinären Transgender Versorgungscentrum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (ITHCCH) arbeiten 11 medizinische Fachdisziplinen in der Trans-Gesundheitsversorgung zusammen. Erwachsene trans Personen stellen sich zunächst in der Spezialambulanz für Sexuelle Gesundheit und Transgender Versorgung vor, Jugendliche in der Spezialsprechstunde für Geschlechtsidentität. Im Rahmen der psychotherapeutischen Begleitbehandlung erfolgt eine Diagnostik und die gemeinsame Planung des individuellen Transitionsweges. Angestrebte somatische Behandlungen können hier indiziert und im Kontakt mit den somatischen Fachdisziplinen koordiniert werden. Zudem können allgemeine Maßnahmen der Gesundheitsversorgung über das ITHCCH in Anspruch genommen werden.
i2TransHealth zur Verbesserung der Trans-Gesundheitsversorgung
Um Menschen in ländlichen Regionen den Zugang zu einer bedarfsgerechten Trans-Gesundheitsversorgung zu erleichtern, hat das Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und Forensische Psychiatrie des UKE das E-Health Versorgungsmodell i2TransHealth ins Leben gerufen (www.i2transhealth.de).
Während des Rekrutierungszeitraums von Mai 2020 bis Dezember 2021 konnten behandlungssuchende trans Personen in die Studie aufgenommen werden, die mindestens 50 km von Hamburg entfernt in Norddeutschland leben. Sie nahmen regelmäßige Videosprechstunden mit Therapeut:innen der Spezialambulanz für Sexuelle Gesundheit und Transgender-Versorgung wahr. Darüber hinaus konnten sie eine medizinische Versorgung von einem regionalen, geschulten Ärzt:innen-Netzwerk (jeweils eine hausärztliche und fachpsychiatrische Praxis an sechs Standorten) in Anspruch nehmen. Nach vier Monaten endete die Studie jeweils für die teilnehmende Person, der anschließend eine Weiterbehandlung im Transgender-Centrum des UKE ermöglicht wurde.
Wirksamkeit in randomisiert-kontrollierter Studie nachgewiesen
Die Wirksamkeit des Versorgungsmodells wurde im Rahmen einer randomisiert-kontrollierten Studie überprüft (Nieder TO et al. 2022). Die subjektiven Erfahrungen im Projekt i2TransHealth zeigten, dass E-Health-Angebote eine wertvolle Unterstützung bestehender Versorgungsstrukturen sein können. Die wissenschaftliche Ausarbeitung der Intervention wird objektivieren, ob mit i2TransHealth ein wirksamer Baustein gefunden wurde, der sich nachhaltig dafür eignet, bestehende Barrieren zu einer gleichberechtigten Gesundheitsversorgung für trans Personen zu reduzieren.
Der Zugang zu einer transitionsunterstützenden Hormontherapie hat in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung für trans Personen. Im Rahmen des Transgender-Versorgungscentrums ist dies im Kontext der Endokrinologie für trans Personen mit oder ohne Vorerkrankungen möglich. Im folgenden Abschnitt gehen wir daher auf mögliche Besonderheiten bei der Hormonbehandlung und Diabetes ein.
Mortalität kann durch Hormonbehandlung erhöht sein
Die transitionsunterstützende bzw. geschlechtsangleichende Hormontherapie kann einen Einfluss auf kardiovaskuläre Erkrankungen und Diabetes mellitus (DM) bei trans Personen haben und im Zuge dessen die Mortalität und Morbidität erhöhen. In einer Kohortenstudie mit 2927 trans Frauen und 1641 trans Männern war die Mortalität bei trans Personen mit Hormontherapie erhöht und scheint unabhängig von der Art der Hormontherapie zu sein. Zu den Todesursachen zählten auch kardiovaskuläre Erkrankungen, die eng mit DM Typ 2 verknüpft sein können (de Blok C et al. 2021). Daten von 2585 trans Frauen und 1514 trans Männern aus der gleichen Kohortenstudie konnten jedoch zeigen, dass die Inzidenz von DM Typ 2 im Vergleich zur Normalbevölkerung nicht erhöht ist (van Velzen D et al. 2022).
Hinweis auf höhere Insulinsensitivität bei trans Männernund niedrigere Insulinsensitivität bei trans Frauen
Allerdings gab es in den letzten Jahren einige Studien, die sich mit der Insulinsensitivität bei trans Personen beschäftigt haben. Shadid et al. (2020) berichtete, dass sich bei trans Personen einige, aber nicht alle, untersuchten Parameter für Insulinsensitivität unter der Hormontherapie verändern. Die Studie lässt vermuten, dass sich die Insulinsensitivität bei trans Männern (n = 35) während der Hormontherapie erhöht und bei trans Frauen (n = 55) erniedrigt. Diese Veränderungen waren vor allem mit der Veränderung des Körperbaus erklärbar: Bei trans Frauen erhöhte sich der Fettanteil, bei trans Männern die Muskelmasse (Shadid S et al. 2020).
In zwei Publikationen wurde sogar über eine Häufung von Diabetes mellitus Typ 1 unter trans Personen berichtet (Belgien: 9 von 1081; Defreyne J et al. 2017) und trans Jugendlichen (USA: 11 von 1114; Maru J et al. 2020). Ein kausaler Zusammenhang wurde nicht beschrieben.
Monitoring von trans Patient:innen mit Diabetes unter Hormontherapie
Trans Patient:innen, die bereits an Diabetes erkrankt sind, müssen während der Hormontherapie besonders überwacht werden. Bei trans Frauen kann es aufgrund einer erhöhten Insulinresistenz zu Hyperglykämien kommen, bei trans Männern aufgrund der erhöhten Insulinsensitivität eher zu Hypoglykämien. Die Dyslipidämie muss bei allen trans Personen überwacht werden. Bei jungen trans Personen, die ihre Pubertät mit GnRH (Gonadotropin-Releasing-Hormon) supprimieren, muss auf mögliche Hyperglykämien geachtet werden (Moverley J et al. 2021). In einer Studie aus den USA fand sich ein erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolien und ischämische Herzinfarkte bei trans Frauen (n= 2842; Getahun D et al. 2018), jedoch nicht bei trans Männern. In einem Review hinsichtlich kardiovaskulärer Risikofaktoren wurde beschrieben, dass das Risiko für arterielle Hypertonie, Dyslipidämie und Insulinresistenz bei trans Männern nicht erhöht ist, aber dass einige Marker für kardiovaskuläre Erkrankungen bei trans Männern (z.B. Bauchumfang, viszerales Fett, Blutdruck, BMI und LDL) und einige Marker bei trans Frauen (viszerales Fett, BMI) erhöht waren (Defreyne J et al. 2019).
Trans Personen in Präventionsprogrammen und in Studien berücksichtigen
Aufgrund der aktuellen Studienlage geht man davon aus, dass die Hormontherapie bei einzelnen Personen das Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 und kardiovaskuläre Erkrankungen erhöht. Dies legt den Fokus vor allem auf Vorsorge und Prävention bei trans Patient:innen, um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu therapieren. Screening-Programme für DM Typ 2 und kardiovaskuläre Erkrankungen erreichen trans Personen jedoch nicht im gleichen Maße wie cis Personen, da der Zugang zum Medizinsystem für trans Personen im Vergleich zu cis Personen eingeschränkt ist (Tanpricha V et al. 2022). Ärzte und Ärztinnen, die trans Personen versorgen, sollten auch diese Personengruppe in Präventionsprogramme miteinschließen und individuelle Behandlungskonzepte finden.
In Bezug auf Trans und Diabetes bzw. kardiovaskuläre Erkrankungen sind noch viele Fragen offen. Hier fehlen auch aktuell noch longitudinale und prospektive Studien, die trans Personen über mehrere Jahre untersuchen, um die Versorgungsituation und die Behandlung zu verbessern (Tanpricha V et al. 2022).
Literatur beim Verlag
| [1] | Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und Forensische Psychiatrie, Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf; | |
| [2] | Kinder- und Jugendmedizin, St. Franziskus Hospital Münster, Zentrum für Reproduktionsmedizin, Universitätsklinikum Münster |
Lea Pregartbauer, M.Sc.
Erschienen in: Diabetes-Forum, 2022; 34 (12) Seite 22-26